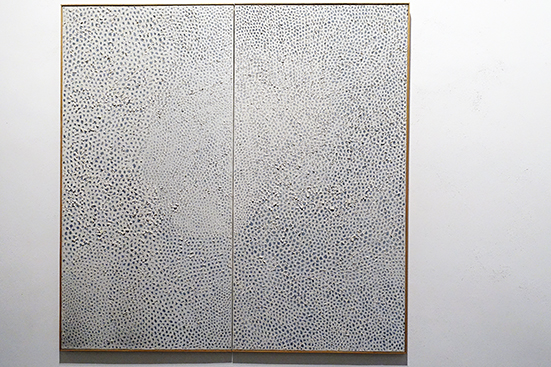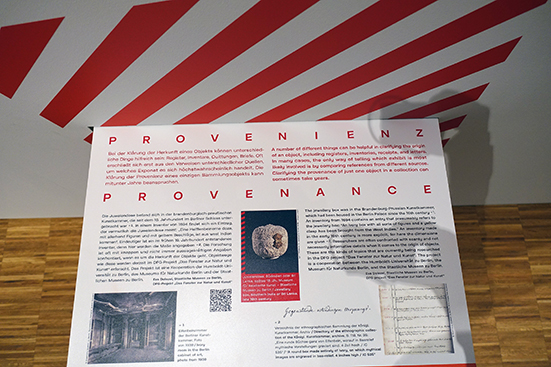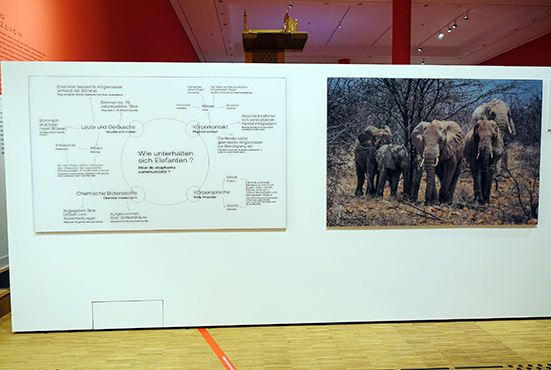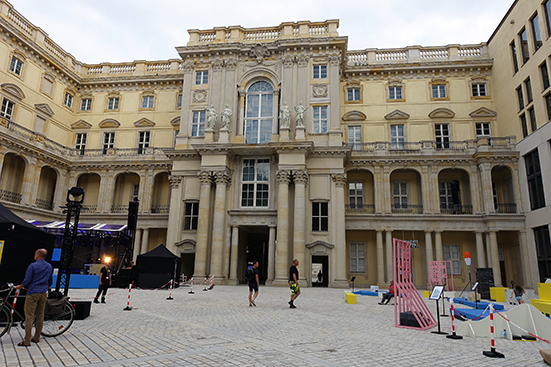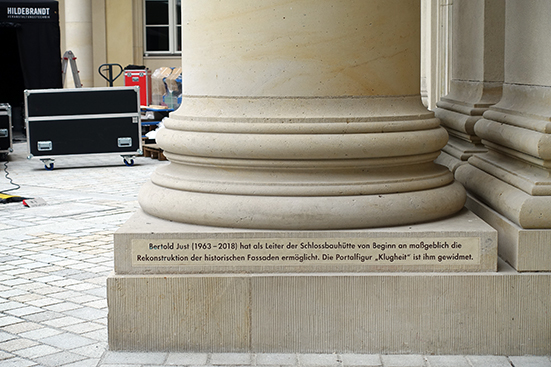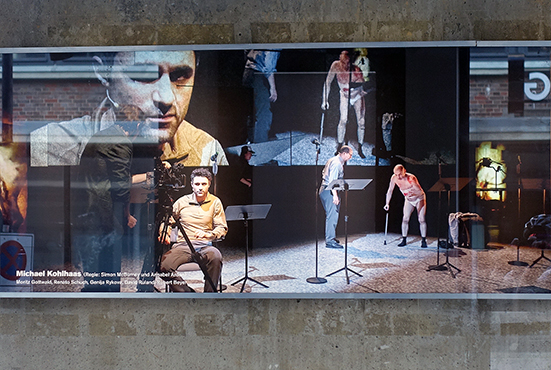Energie – Archäologie – Klang
Auditive Kraftfelder
Zu Ann Cleare und Enno Poppe mit dem Ensemble Musikfabrik beim Musikfest Berlin 2021
Am 5. September konnte mit dem Ensemble Musikfabrik unter der Leitung von Aaron Cassidy mit den Kompositionen von Ann Cleare eine Entdeckung gemacht werden: Musik ist nicht nur ein auditives Ereignis. Bei Ann Cleare wird sie physisch und physikalisch, sie wird kommunikativ und verbindend. Insbesondere mit erweiterten Spieltechniken der Instrumente entweder als Bläserquintett oder als großes Ensemble mit Harfe lässt die irische Komponistin Klänge entstehen, die sich jenseits der traditionellen Klangspektren ausbreiten. Beispielsweise lässt sie die Saiten der Harfe mit einem runden Stein streichen statt zupfen. Dadurch werden die Saiten auf ganz andere Weise in Schwingungen versetzt, die Töne hervorbringen. Die Uraufführung von Fossil Lights unter der Leitung von Aaron Cassidy wurde vom Publikum gefeiert.

Das diesjährige Musikfest Berlin wird nicht zuletzt davon geprägt, dass die Uraufführungen oft wie bei Prozession von Enno Poppe bereits digital stattgefunden haben. Die durch die CoVid-19-Pandemie bedingten „digitalen Konzert(e)“ konnten offenbar doch nicht die gleiche Aufmerksamkeit und Reichweite entfalten wie das Livekonzert auf dem Podium. Neben dem Konzertwissen und seinen Praktiken, auf die Enno Poppe nicht verzichtet, gibt es eine Art Alchemie des Konzerts, die nur mit Publikum stattfinden kann. Zwischen Studioaufnahmen und Livemitschnitten gab es immer einen hörbaren Unterschied. Die die einzelnen Instrumente im Ensemble Musikfabrik herausarbeitende Komposition wandelt den Prozess des Musikmachens um in eine Prozession. Enno Poppe dirigierte sein Werk selbst, das er als Auftragswerk des Ensemble Musikfabrik geschrieben hat.

Für Ann Cleare wie Enno Poppe nehmen Auftragswerke für Ensembles eine entscheidende Funktion im Schaffen als zeitgenössische Komponist*innen ein. Die enge, oft wiederholte Zusammenarbeit eines Ensembles mit einer Komponist*in generiert eigene Effekte in der Spielpraxis der Instrumente und damit neue Klangspektren. So war bespielweise mire /…/ veins (2013) von Ann Cleare ein Auftragswerk des Ensembles Apparat, das ein reines Blechbläser-Ensemble war, und das nun von den Blechbläsern im Ensemble Musikfabrik gespielt wurde. Gleichwohl beschreibt die Komponistin für ihr Bläserquintett einen intensiven Prozess des Musikmachens, der nicht nur an die einzelnen Instrumentalisten gebunden ist. 2 Trompeten, Horn, Posaune und Tuba werden von Cleare so komponiert, dass ein kommunikativer Prozess im Quintett einsetzt:
„In contrast to the other chamber groups, the French Horn acts as an agent of communication and connection. It can blend into the activity of either group, transmitting and translating information and building a network between the insularity of both places, breathing new air into the stubborn impermeability of the two chamber groups.“[1]
(Im Kontrast zu den anderen Kammergruppen fungiert das Waldhorn als Kommunikations- und Verbindungsorgan. Es kann sich in die Aktivität einer der beiden Gruppen einfügen, Informationen übermitteln und übersetzen und ein Netzwerk zwischen der Abgeschiedenheit beider Orte aufbauen und der hartnäckigen Undurchlässigkeit der beiden Kammergruppen neue Luft einhauchen.)

Ann Cleare hat sich nicht nur mit ihren Titeln, vielmehr mit verschiedenen Verfahren aus der Physik kompositorisch auseinandergesetzt. Für ore (2016) notiert sie als einen Wink auf ihr Komposition, dass Erz ein mineralreicher Stein sei, aus welchem einige Materialien extrahiert werden könnten.[2] Michele Marelli, Klarinette, führte das Stück mit dem Streichtrio des Ensembles Musikfabrik auf. Klanglich situiert sich das Stück im Obertonbereich. Aus der Höhe der Klarinette und der Streicher ergibt sich ein Klang, aus dem sich metonymisch „various materials“ herausziehen lassen. Auch Fossil Lights (2020/21) ist kammermusikalisch mit Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier angelegt. Ähnlich wie bei ore geht es um ein physikalisches Verfahren und Denken, das in einer Komposition erprobt wird. Fossilien sind Versteinerungen von organischem Leben früherer Erdzeitalter. Doch wie lässt sich fossiles Licht denken? Wie materiell, physisch ist Licht, das sich ausgraben lässt? Ann Cleare knüpft dafür an den irischen Mythos „unzähliger ritueller Feuer, die einst von den Midlands aus die gesamte irische Insel mit spiritueller Energie versorgt haben sollen“.[3]

Irische Mythologie und physische Materialität werden in Fossil Lights zu einem Klangspektrum. Ann Cleare ist nicht zuletzt eine Klangforscherin, was an dieser Komposition deutlich wird. In einem poetologischen Verfahren werden auditive Bereiche kombiniert, die bislang kaum zusammen gedacht worden sind. Das macht die besondere Kompositionsweise der Komponistin deutlich. Immer geht es um Bereiche, die bislang nicht der Akustik zugerechnet wurden. Die irische Mythologie der „Mide“, einer verlorenen Mitte und Kraftzentrum sowie zugleich fünfte Provinz Irlands, wo sich die Menschen im Frühling zum Ritual der Erneuerung versammelten und Feuer entzündeten, wird nicht symphonisch erzählt, vielmehr wird ein auditives Verfahren erprobt, um „Fossil Light Pattern“ zu komponieren. Beethoven erzählte in der Pastorale etwa von einer Landpartie, während welcher eine ganze Gefühlsdramaturgie abgespielt wird, wie es Sir Simon Rattle mit dem London Symphony Orchestra vorgeführt hatte. Ann Cleare forscht:
„Ihr Forschungsmaterial waren Tonaufnahmen der legendären Orte und Fossilien. „Fossil Lights versucht diese verlorenen Orte, ihr Licht und ihren Geist auszugraben“, erklärt Cleare ihre spekulative Anverwandlung der Archäologie. Im Zentrum der Komposition steh ein „Fossil Light Pattern“, das aus der Verstärkung einzelner Töne der Feldaufnahmen aus den Midlands entstanden ist.“[4]

Die auditive Archäologie, wie sie von Cleare formuliert und praktiziert wird, erinnert mich an die künstlerische Intervention und kreative „Feldforschung“ der bildenden Künstler*innen Helene von Oldenburg und Claudia Reiche, die für ihre Ausstellung wo es war – Ortsbestimmungen zu fünf Objekten im Landesmuseum Birkenfeld den erfolgreichen „Sondengänger“ Sascha Theis am 24. September 2020 auf einem Acker bei Hottenbach interviewt haben.[5] Denn es wäre vermutlich auch bei Fossil Lights die Frage, ob zuerst die Feldforschung betrieben wurde und dann Erzählung hinzukam oder umgekehrt. Der „Sondengänger“ Sascha Theis antwortet, wie vielleicht auch Cleare antworten würde:
„ST Genau. Genau, das haben sie gebraucht, ja. So. Und das war jetzt… Also ich kenne die ganzen Aussprüche, aber wenn man jetzt hier die Gegend abschließt, ja… [lacht]. Dann ja hier oben, auf dem Höhenkamm, wo die Tannen stehen, also hier im linken Bereich schon im Höhenkamm, dort sind insgesamt sechs keltische Hügelgräber zu finden, also, wo dieser Kamm hier ist. Und wenn man den Kamm ganz nach rechts geht, wo diese Tannengruppe aufhört, dort ist auch nochmal ein Hügelgräberfeld mit Hügelgräbern, nicht? Ist halt eine Höhenstraße. Die keltischen Hügelgräber sind immer an Verkehrsverbindungen gebaut worden, ja. Die wollten sich präsentieren, ja. (…)
CR Ja, das ist sehr beeindruckend. Es wächst richtig vor dem geistigen Auge, was hier früher gewesen sein könnte. Sie erzählen es so, weil Sie gehen auch so auf die Landschaft ein. Was hätte sich gut geeignet dafür? Also,… das kann man sich bestimmt sehr gut vorstellen, wenn man hier das so genau kennt wie Sie, und sich nochmal richtig mit den Einzelheiten des Bodens und der Winde und des Wetters auseinandersetzt…“[6]

Ann Cleare erzählt von ihren Kompositionsverfahren, aber nicht von den „Midlands“ mit den Feuern in ihren Kompositionen. Das unterscheidet sie als Komponistin in ihrer Feldforschung beispielsweise von einem „Sondengänger“ wie Sascha Theis. Erzählt man allerdings im Voraus ausführlicher von „Mide“ und den „Midlands“ als einer mytho-logisch „verlorene(n) Mitte“, die sich wenigstens in einer Erzählung suchen und finden ließe, dann könnte in einem auditiven Vorgang doch eine Art „Film“ – Tonfilm – entstehen, wie Claudia Reiche auf Sascha Theis‘ Erzählung entgegnet: „Ja, es ist wirklich so: Wo Sie es beschrieben haben, kam das ja alles so hier vorbei: mögliche Menschenzüge, die Münzen… Es ist eben schon so wie ein Film gewesen, was bei mir entstanden ist.“[7] Doch Cleare entwickelt keine Musiksprache, die erzählen wollte, vielmehr hält sie sich an den Grenzen der Wahrnehmung und Verortung. Das Klavier wird als Schlagzeug verwendet, die Klarinette wird auf virtuose Weise in Obertonlage versetzt. Das Quintett soll sich vielmehr „in eine Lichtskulptur oder Lichtmaschine, in der das Klavier das Trio um sich herum entzündet,“ verwandeln.[8] Auf diese Weise wird Fossil Lights zu einer klangenergetischen Komposition.

Ann Cleare spricht von ihrer Komposition als eine Lichtskulptur, die insofern von der Klarinette, der Violine und dem Violoncello in einem Obertonbereich erzeugt wird. Zumindest in der Klanghöhe gibt es eine Anspielung auf eine auditive Darstellung von Licht. Den Instrumentalist*innen, Michele Marelli, Hannah Weirich und Dirk Wietheger sowie Ulrich Löffler am Klavier werden von der Komponistin virtuose Spielweisen abverlangt. Alle sind auch als Solisten tätig. Das Ensemble Musikfabrik wird für seine solistischen, virtuosen Fähigkeiten wertgeschätzt und gerühmt. Die Instrumente werden immer wieder auf neue Spielpraktiken ausgelotet. Aaron Cassidy dirigierte die Uraufführung von Fossil Lights sowie die Stücke the physics of fog, swirling (2018/2019) und on magnetic fields (2011/2012) energiereich. Auf diese Weise fand beim Musikfest Berlin die Uraufführung statt, die von der National Concert Hall, Dublin und The Office for Public Work, Irland, in Auftrag gegeben worden war.[9] Cleare erforscht mit Fossil Lights ebenso das Genre des Quartetts, das von ihr nicht nur instrumental neu kombiniert, sondern auch klanglich erweitert wird.

Enno Poppe lässt mit Prozession mit dem Ensemble Musikfabrik und für dieses ein auditives Voranschreiten der Instrumente entstehen. Nach und nach werden die Instrumente – Flöte, Oboe, Klarinetten, Trompete, Hörner, Posaune Schlagzeug, Syntheziser, E-Gitarre, Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass – in erweiterten Spielweisen intoniert. Sie bauen ein Klangvolumen auf, um dann wieder einzeln hörbar zu werden. Neue Fassung von Prozession wurde am 22. November 2020 im Rahmen des Ensemblefestivals Leipzig als „digitales Konzert“ mit dem Ensemble Musikfabrik aufgeführt. Die Form des „digitalen Konzerts“ wäre noch einmal genauer zu erforschen. Sie hat sich irgendwo zwischen Rundfunk- und Fernsehübertragung angesiedelt, um allerdings ausdrücklich ein Konzert mit Publikum zu ersetzen.[10] Bereits 2015 hatte Enno Poppe eine 49minütige Fassung von Prozession komponiert.[11] Ob die neue Fassung des Stückes mit dem zumindest religiösen Titel in Bezug auf die Covid-19-Pandemie bearbeitet worden ist, entzieht sich der Kenntnis. Doch die üppige Besetzung des Ensembles mit 4 Spieler*innen am Schlagzeug sowie 2 Synthezisern gibt ein Wink auf einen orchestralen Anspruch.

Prozession baut sich sehr langsam zu symphonischen Klangwolken auf, die sich in Rhythmen bis zu Jazz und Tanzmusik entladen. Aus den Synthezisern kommen Orgeltöne, die an eine religiöse Klangtradition erinnern können, ohne dass ein religiöses Gefühl erzeugt werden soll. Poppe dirigiert, wie er komponiert: präzise, kantig, durchdacht. Prozession wird im September 2021 zu einem anderen auditiven Erlebnis als 2015. Die Wahrnehmung hält sich für mich zwischen einem Nachdenken über die Form der Orchestermusik wie der Prozession als religiöse Praxis. Wohl mag auch Poppes Musik Gefühle wecken, doch er schreibt und dirigiert keine Gefühlsmusik. Die Kombinatorik der Instrumente im Ensemble wie Koordinierung des Klangs machen Prozession zu einer symphonischen Klangperformanz intensiver Eigenart.
Torsten Flüh
Musikfest Berlin 2021
noch bis 20. September 2021
[1] Ann Cleare: mire |…| veins For Brass Quintet. In: Ann Cleare: Works.
[2] Ann Cleare: ore for one high reed wind instrument (clarinet/oboe/saxophone) and string trio. In: Ann Cleare: Works.
[3] Zitiert nach Martina Seeber: Komponieren als taktile Tätigkeit. Über die Komponistin Ann Cleare. In: Musikfest Berlin (Hg.): Ensemble Musikfabrik I Porträt Ann Cleare & Ensemble Musikfabrik II Enno Poppe: “Prozession” 05.09.2021, S. 10.
[4] Ebenda.
[5] Helene von Oldenburg, Claudia Reiche: Feldforschung – GOTT In: dies.: wo es war Ortsbestimmung zu fünf Objekten im Landesmuseum Birkenfeld. 2021-2022. Birkenfeld 2021, S. 22-29. Auch: www.woeswar.de
[6] Ebenda S. 26.
[7] Ebenda.
[8] Zitiert nach Martina Seeber: Komponieren … [wie Anm. 3] S. 10.
[9] Vgl. zur National Concert Hall: Torsten Flüh: Dublin hören. Donncha Dennehys Crane und das Freitagskonzert von Raidió Teilifís Éireann. In: NIGHT OUT @ BERLIN Februar 21, 2017 22:51.