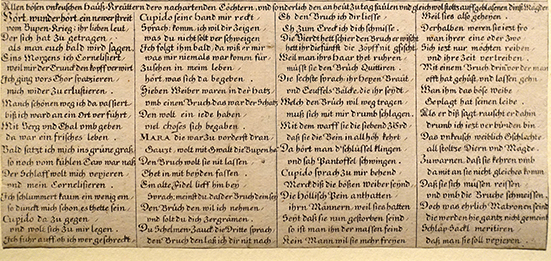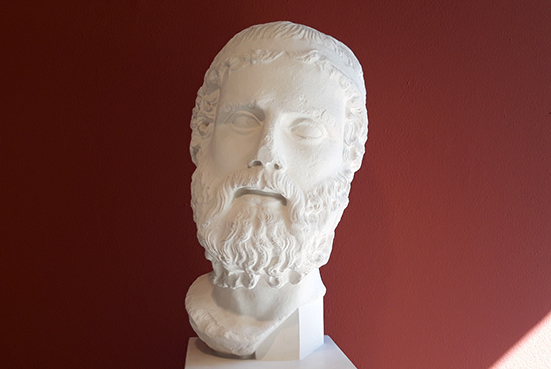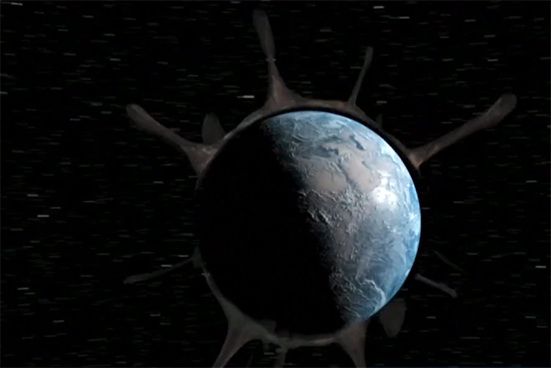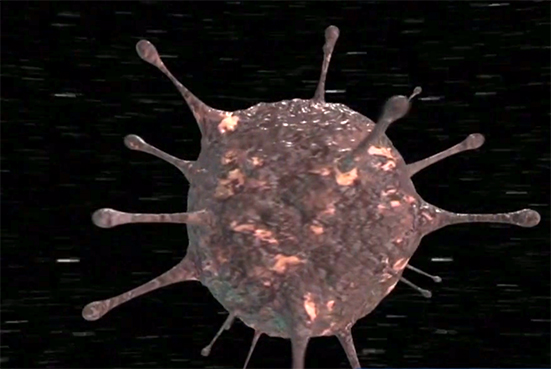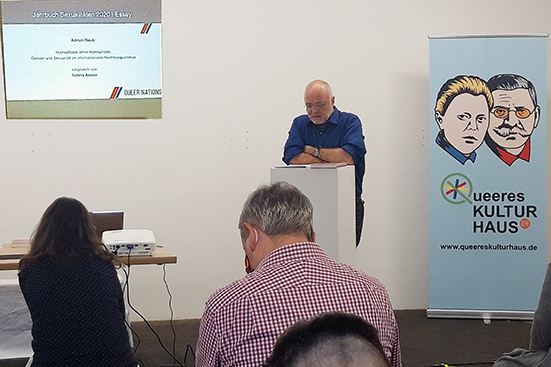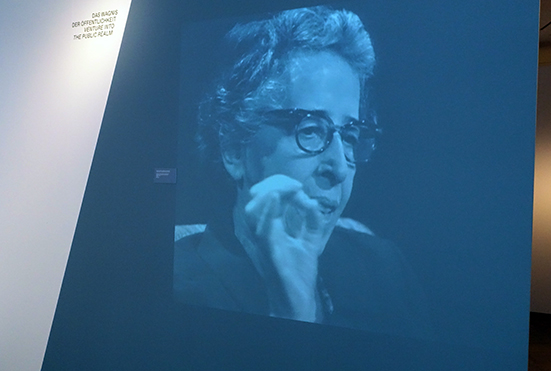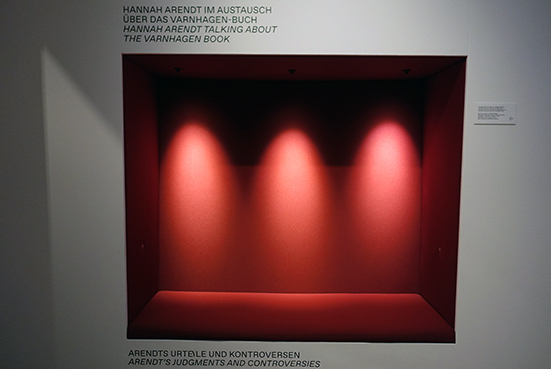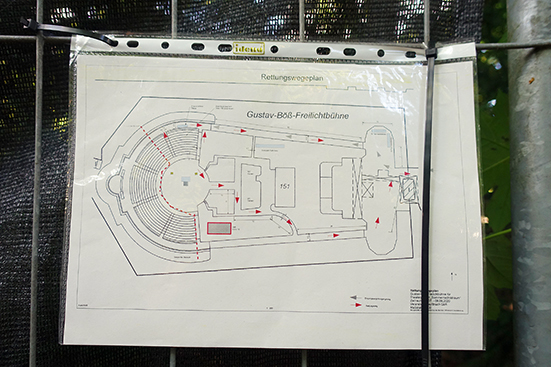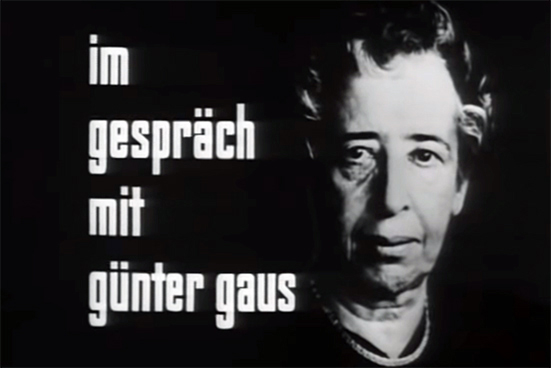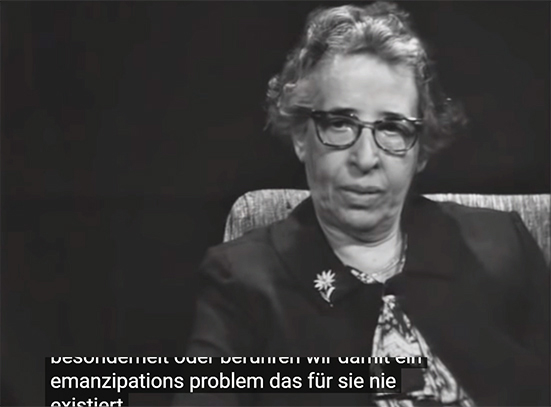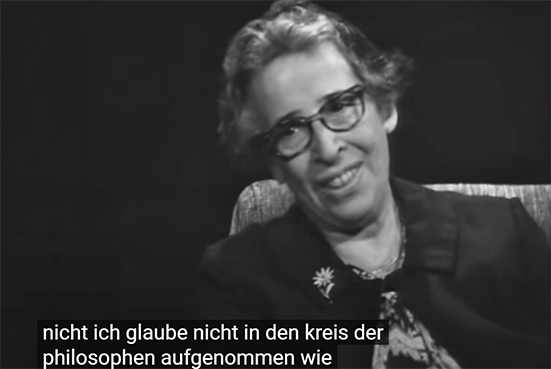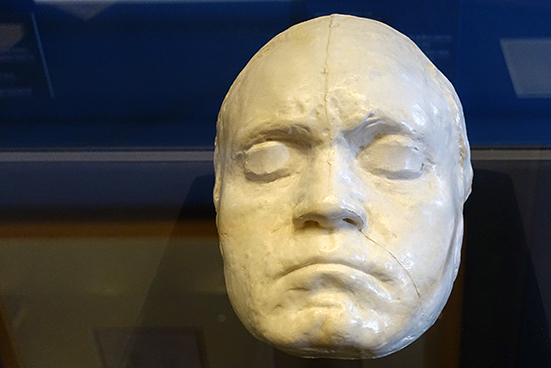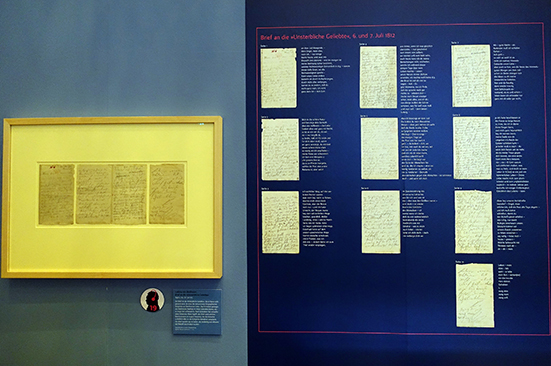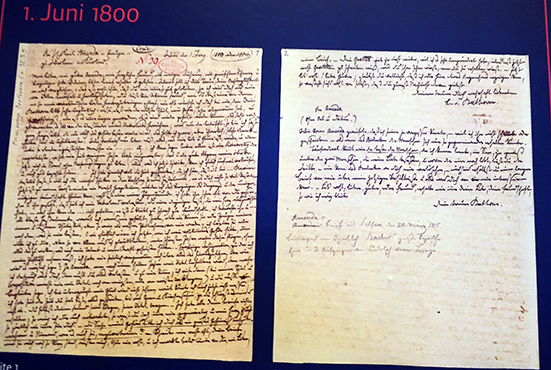Klavierkonzert – Trauer – Sonatenform
Allegro con brio, doch auch ein wenig traurig
Igor Levit spielt Ludwig van Beethovens 32 Klaviersonaten beim Musikfest Berlin
Die Klaviersonate Nr. 21 in C-Dur, genannt „Waldstein“, eröffnet im ersten Satz mit dem Tempo und der Stimmungsangabe Allegro con brio. Igor Levit hat die Sonate für sein erstes Konzert in der Berliner Philharmonie als vierte ausgewählt. Er spielt in seinen 8 Klavierkonzerten also nicht Sonate Nr. 1 bis Sonate Nr. 32 chronologisch nacheinander weg, vielmehr beginnt er zwar mit der heiteren und noch ganz klassischen Sonate Nr. 1 in f-Moll, Beethovens Opus 2 überhaupt, das erste von 8 Konzerten. Doch dann kombiniert er die Sonaten auf eigene Weise: Nr. 12, Nr. 25, Nr. 21. Das ist ein künstlerisches Statement, eine Komposition. Allegro con brio, also schnell/fröhlich mit Schwung in C-Dur ist musikalisch schon sehr fröhlich. Nach dem finalen Prestissimo, äußerst schnell, und einer kurzen Stille durchdringen Bravo-Rufe den Konzertsaal. – Doch nichts ist wie gewohnt.

Ja, es gibt Bravo-Rufe, stürmischen Beifall für Igor Levits erstes Klavierkonzert, doch unter Einhaltung der Regeln zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Die Stiftung Berliner Philharmoniker und die Berliner Festspiele haben als Veranstalter mit Experten aus der Charité ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet, das es überhaupt erlaubt, Konzerte in der Philharmonie stattfinden zu lassen. Die eingeladenen, internationalen Orchester aus Amsterdam und USA können nicht anreisen. Das Programm des Musikfestes Berlin 2020 ist nach den nationalen und internationalen Regeln zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie modifiziert worden. Das ist schmerzlich. Trotzdem sind die Musiker*innen, Orchester, Kurator*innen und Organisator*innen glücklich, überhaupt spielen zu dürfen. Wer eine Karte für die ausverkauften Konzerte ergattert hat, freut sich wie der Berichterstatter über alle Maßen und ist dankbar. Endlich wieder Musik live nach mehr als 6 Monaten. Die Philharmonie ist ausverkauft, doch fast leer.

Der Rahmen gehört zur Musik. Eine Mitarbeiterin der Philharmonie tritt mit Mikrofon ruhig auf die Bühne: „Guten Abend verehrtes Publikum. Sie dürfen jetzt auf Ihren Sitzplätzen die Maske abnehmen. Nach dem Konzert setzen Sie bitte die Mund-Nasen-Bedeckung wieder auf und verlassen das Gebäude auf dem Weg, den Sie gekommen sind …“ So oder so ähnlich lautet jetzt die Begrüßung in der Philharmonie und in anderen kulturellen Einrichtungen wie Theatern und Konzertsälen wird es nicht anders sein. In der Philharmonie sind alle Mitarbeiter*innen indessen noch ein wenig freundlicher und stilvoller. Die meisten Mitarbeiter*innen tragen stilvolle, dunkelviolette Mund-Nasen-Bedeckungen, MNB, mit dem Philharmonie-Logo. Ein Farbenleitsystem sorgt für den Zugang zum Sitzplatz. Keine Garderobe. Keine Abendprogramme. Keine Pausen mit Getränken und Häppchen. Der Konzertbesuch in Corona-Zeiten verlangt ein hohes Maß an Disziplin und Verzicht.

Die MNB ist (in Deutschland) zum Mode- und Kultobjekt geworden. Als meine Mutter im April die ersten Masken für mich, Familie und Freunde nähte, sagte ein Freund noch: „Niemals. Ich bin doch kein Chinese.“ Die Maske hat sich als schick durchgesetzt. Weltkunst verkaufte Masken für die Kunstwelt in limitierter Auflage. Ich bestellte Norbert Biskys Painkiller für mich und eine andere Kunstmaske für einen Freund zum Geburtstag. Der Painkiller ging auf unerklärliche Weise auf der Rückbank eines Autos bei einem Ausflug zur Vernissage einer Wilhelm Imkamp-Ausstellung im Fagus Werk von Walter Gropius in Ahlfeld verloren. Jetzt trage ich eine hell türkise Maske aus japanischem Tenugui-Stoff mit weißen Koi. Es spricht für einen gewissen Mangel an praktischer Intelligenz, wenn sich Menschen der Mund-Nasen-Bedeckung im ÖNV oder in der Philharmonie verweigern. Sie kommen einfach nicht in die Philharmonie hinein. So ist das! Nach der freundlichen Mitarbeiterin der Philharmonie betritt die Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grüter, mit MNB die Bühne, nimmt am mittig aufgestellten Mikrofon die Maske ab und beginnt ihre Rede. – Ein neues Ritual.

Die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin spricht in ihrem Grußwort davon, dass die Kultur und die Musik, die „Kunst überlebensnotwendig für unsere Demokratie“ und die Gesellschaft seien. „Das Musikfest Berlin zeige, dass gemeinsamer Kulturgenuss auch unter den geltenden Beschränkungen möglich sei, freute sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters. In ihrer Eröffnungsrede unterstrich Grütters nicht nur die Bedeutung des gemeinsamen Erlebens von Kunst und Kultur. Sie wies auch darauf hin, wie wichtig gerade in Zeiten der Krise die kreativen Impulse und Innovationen seien, die von Künstlern, von Komponisten, von der neuen Musik und auch von Beethovens Werken ausgingen.“[1] Sie erinnerte daran, dass Igor Levit ab dem 12. März 2020 eine Reihe von 52 „Hauskonzerten“ aus seiner Berliner Altbauwohnung auf Twitter übertrug. Tausende Followers verfolgten die „Hauskonzerte“ am Flügel. Levit war offenbar allein in der Wohnung. Er stellte absolut unprätentiös seine Webcam auf und an, begann in Socken eine kurze Einführung zum Stück und spielte ein äußerst abwechslungsreiches Programm.

Die „Hauskonzerte“ und der Twitter-Account verraten viel über den Pianisten Igor Levit und sein gesellschaftliches Engagement. 2019 veröffentlichte er bei Sony Classical die Einspielung der kompletten Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven, mit denen er sich zuvor 15 Jahre lang beschäftigt hatte. Ungefähr ab August 2019 folgten überschwängliche Kritiken, Interviews und Porträts auf allen Kanälen. Vier Tage nach Yom Kippur 2019 und nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle nahm Igor Levit an der Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin teil und spielte vor der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße auf einem Flügel. Im November 2019 erhielt er Morddrohungen per E-Mail. Am 2. April 2020 spielte Igor Levit im Schloss Bellevue beim Bundespräsidenten die sogenannte Waldstein von Ludwig van Beethoven, nachdem Frank Walter Steinmeier seine Videobotschaft zur Corona-Epidemie hatte aufzeichnen lassen. Wie sich auch beim eröffnenden Klavierkonzert in der Philharmonie zeigen sollte, engagiert sich Levit auf im Konzertformat unkonventionelle Weise, indem er z.B. als Zugabe eine ihm erst kurz zuvor zugeschickte, neue Komposition des New Yorker Jazzpianisten Fred Hersch mit dem Titel Trees spielte. – Auf Fred Herschs Komposition Trees werde ich zurückkommen.

Die Hauskonzerte auf Twitter sind nicht zuletzt für die Blog-Forschung interessant. Denn Levit nutzte damit als einer der Ersten das Medium Kurz-Blog für Konzerte aus seiner Wohnung, als das öffentliche Leben zum Erliegen gekommen war. Eine einfache Webcam oder gar nur das Smartphone erwiesen sich als so leistungsfähig, dass eine akzeptable Ton- und Bildqualität zum Zuhören einlud. Statt Hasskommentare und Lügenbotschaften verwandelte Levit aus der Not heraus das Medium in einen Raum der Empathie und des Zuhörens. Er half geradezu bei der Strukturierung des Tagesablaufes, weil sich die Follower auf ein Konzert am Abend freuen konnten. Das Repertoire reichte von Schubert bis Orgelchoralvorspiele für Klavier von Johann Sebastian Bach durch Ferruccio Busoni transkribiert am 24. Mai 2020. Richard Wagner war ebenso dabei. Kurioses wechselte mit ganz Großem.

Das Musikfest Berlin stellt seine Konzerte digital als Aufzeichnungen für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. So wird das erste Klavierkonzert von Igor Levit noch bis 3. September 2020 15:59 bereitgehalten. Sie sollten sich also das Konzert anhören. Es war für mich in seiner Kombinatorik der Sonaten – Nr. 1, Nr. 12, Nr. 25, Nr. 21 – überraschend und lehrreich. Wo kommt Beethoven mit seinen Sonaten her? Wo entwickelt er sich hin? Was ist überhaupt eine Klaviersonate? Und wie spielt und spricht Igor Levit über Musik? Igor Levit spielt die Klaviersonaten vor allem aus dem Kopf. Für die Zugabe hat er ein Tablet mit den Noten zur Hand. Das ist nur ein winziger Unterschied, weil es an der Musik nichts ändert. Die Klaviersonaten von Beethoven, so unterschiedlich und komplex sie sein mögen, beherrscht Igor Levit aus seinem Kopf und Körper. Wiederholt gräbt er sich in die Tastatur hinein. Da Beethoven sich in Wien mit der Sonate Nr. 1 f-Moll op. 2 selbst als Klaviervirtuose und Komponist in Wien vorstellt und einführt, entsteht in Anknüpfung an seinen Lehrer Joseph Haydn eine individuelle Auseinandersetzung über das Musikmachen.

Die Sonatenform ist nicht voraussetzungslos, doch wurde sie als Modell zum Komponieren wesentlich nachträglich Ende des 19. Jahrhunderts erforscht und als Musikwissen kanonisiert. Die Josef Hayden gewidmete Sonate ist in 4 Sätzen mit den Tempi Allegro, Adagio, Menuett. Allegretto – Trio und Prestissimo komponiert. Es gibt auch zwei- und dreisätzige Klaviersonaten von Beethoven. Joseph Haydns sechs Klaviersonaten sind allesamt in 3 Sätzen komponiert. Auch die achtzehn Klaviersonaten von Wolfgang Amadeus Mozart haben regelmäßig 3 Sätze. Insofern darf man sicher formulieren, dass Beethoven von Anfang an das Schema oder die Regel durchbricht. Es hört sich, wie das Thema gesetzt und auskomponiert wird, noch recht geordnet und regelhaft an. Haydn und Mozart lassen grüßen. Doch bereits in der ersten Klaviersonate wird durch Variation ein Eigensinn hörbar. Besonders der dritte Satz, Menuett. Allegro – Trio, fällt aus dem Schema. Die Sonate bleibt aber nach der Lehrmeinung im ersten Satz der Sonatenhauptsatzform von Exposition, Durchführung, Reprise und Coda verschrieben.[2]

Die Widmungen der Klaviersonaten haben zu vielfachen Spekulationen in der Musikgeschichte und der Interpretation geführt. Josef Haydn die Sonate Nr. 1 zu widmen, leuchtet ein und ist unverfänglich, zumal dann wenn an die Sonatenform des Lehrers angeknüpft wird. Doch die erste Sonate unterscheidet und setzt sich auch deutlich ab von der Lehre des Meisters. Die Widmung bekommt als Ehrerbietung und Abgrenzung, wenn nicht Überbietung einen ambivalenten Zug. Zumal schon Graf Ferdinand von Waldstein-Wartenberg Beethoven ins „Stammbuch“ geschrieben hatte: „Sie reisen itzt nach Wien zur Erfüllung ihrer so lange bestrittenen Wünsche. Mozart’s Genius trauert noch und beweinet den Tod seines Zöglinges. Bey dem unerschöpflichem Hayden fand er Zuflucht, aber keine Beschäftigung; durch ihn wünscht er noch einmal mit jemanden vereinigt zu werden.“ Er hielt Haydn für geniefrei. Die Widmung der Sonate Nr. 12 an Fürst Karl von Lichnowsky lässt sich als Dank für mäzenatische Förderung lesen, weil der Fürst zuvor schon Mozart als Mäzen finanziert hatte. Es geht insofern um eine gegenseitige Wertschätzung. Doch es ist auch bekannt, dass sich der Fürst von Lichnowsky mit Mozart wie mit Beethoven über finanzielle Angelegenheiten überwarf. In der Wertschätzung schimmert eine gewisse feudale Abhängigkeit und Macht durch. Die Widmung der Sonate Nr. 21 an Graf Ferdinand von Waldstein, dem ersten Förderer Beethovens noch in Bonn, gibt in gewisser Weise Rätsel auf, weil Beethoven um 1804 in Wien offenbar keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Mit dem Namen der Grafen durch die Widmung versehen wird ein Verhältnis generiert, von dem sich wiederum kaum wissen lässt, ob es für die Komposition eine Rolle spielte. Die Praxis der Widmung als Benennung wird allerdings gern als Wissensgeste aufgegriffen.

Die Widmung kann auch die Form einer Adressierung annehmen: Komponiert als ein Gedanke an… Wir wissen nicht, ob Fred Hersch Trees ausdrücklich Igor Levit gewidmet hat. Soviel Levit erzählt, hat Hersch ihm die Komposition wohl wie heute üblich per E-Mail zugeschickt. Sie sei etwas Gutes, das während der Pandemie und des Lockdowns entstanden sei, wie Levit sagt. Und die Komposition ist „zart, ja, zart“. Das ist viel gesagt vor einer Zugabe im klassischen Konzertbetrieb. Fred Hersch, der die zarte Musik an der Grenze von Klassik und Jazz während der Covid-19-Pandemie komponiert hat, ist gewissermaßen ein Experte für Epidemien. Er ist ein Überlebender der AIDS-Epidemie in den 90er Jahren, was er öffentlich wiederholt gesagt hat. „In the early ’90s, we all thought we were going to die. (…) My friends were dropping like flies.“[3] Fred Hersch möchte in erster Linie als Jazzpianist und Komponist wahrgenommen. Doch seine Kompositionen würden ohne die Erfahrung der Epidemie und der eigenen AIDS-Erkrankung möglicherweise anders ausfallen. „I’d like for people to think I’m a reasonably nice person, a good musician, and that I just happen to be gay and I’m dealing with a disease. It’s not the first thing in the file folder.“[4] Der Lockdown war nicht zuletzt eine Wiederkehr der Epidemie-Erfahrung für Hersch, der darauf mit Zartheit in Trees reagierte. – Igor Levit brachte Trees als Zugabe in der Philharmonie beim Musikfest Berlin mit größter Konzentration und Zartheit zur Uraufführung. Ein Widmung.
Torsten Flüh
Musikfest Berlin
Igor Levit spielt Beethoven
Musikfest Berlin digital
[1] Monika Grütter: Kultur erleben – mit Abstand oder digital. Die Bundesregierung 26.08.2020. Musikfest Berlin.
[2] Vgl. dazu Markus Gorski: 1. Satz aus der Klaviersonate op.2, Nr.1, f-moll. In: Lehrklaenge.de.
[3] Howard Reich: Fred Hersch: Despite struggles, a great pianist flourishes. In: Chicago Tribune September 19, 2012.
[4] Ebenda.